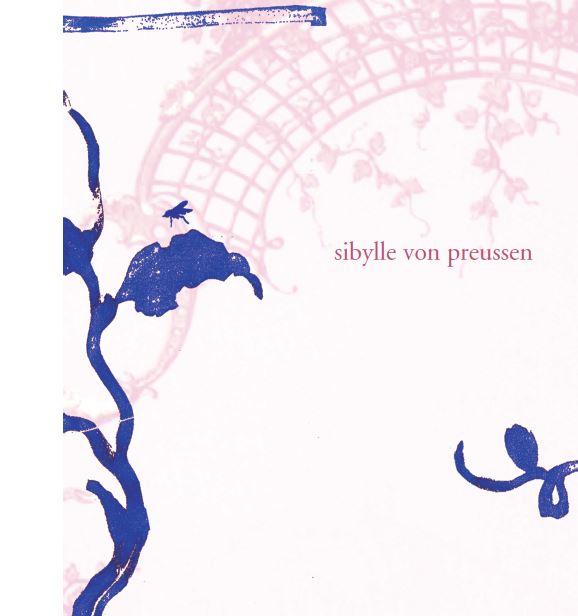
Das Haus am Lützowplatz freut sich, der Berliner Öffentlichkeit neue großformatige Scherenschnitte und Collagen der 1952 in Berlin geborenen Künstlerin Sibylle von Preußen zu präsentieren.
Wie ein roter Faden zieht sich die Idee, ausgrenzende Zuordnungen – die das Gegenüber reduzieren und seine Möglichkeiten beschränken – zu überwinden, durch das Werk Sibylle von Preußens. Andersherum formuliert: Das sensible menschliche Potential und die Würde der Kreatur sind grundlegende Themen der abstrakten und gegenständlichen Arbeiten der Künstlerin.
Ihre großformatigen, zu Beginn der 90er Jahre entstandenen Phoenix-Bilder waren Verweise auf eine Auferstehung aus der Asche, des Glaubens an die menschlichen Möglichkeiten. Diese Arbeiten befinden sich bevorzugt in amerikanischen Sammlungen, aber auch im Amtssitz des damaligen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Werner Knopp, oder im Stadtmuseum Weimar wieder.
Ihre Ende der 90er Jahre folgenden Farblandschaften, „colorscapes“, von denen auch zwei Bilder in der Ausstellung im Haus am Lützowplatz gezeigt werden, waren eine Art gegenstandsloser, poetischer Hinweis auf das Prinzip Hoffnung selbst nach der Vertreibung aus dem Paradies. Ein großformatiges Triptychon aus dieser Zeit, „East of eden“, hängt allgemein zugänglich in der großen Siemensmosaikhalle in Berlin. Der Künstlerin ging es – wie auch bei ihren diversen Kunst am Bau Projekten – um die Schaffung poetischer Räume. Dabei beinhaltet Poesie ein Potential, das dem vergleichbar ist, was Václav Havel einst über die Hoffnung sagte: „Sie ist ein Geisteszustand, kein Zustand der Welt … Sie ist eine Ausrichtung des Herzens; sie transzendiert die unmittelbar erlebte Welt und ist irgendwo hinter deren Horizont verankert.“
Diese den festgelegten Horizont überschreitende, poetische Dimension, die auch Professor Wolf Lepenies, seinerzeit als Rektor des Wissenschaftskollegs zum Werk der Künstlerin hervorhob, findet sich auch in den neuen, kleinen Papierarbeiten, die in der Ausstellung THE ROYAL RABBIT präsentiert werden.
Auch die neuesten, zum Teil großformatigen Scherenschnitte setzen der unmittelbar erlebten Welt eine andere Dimension entgegen. Die Motive entstammen ursprünglich der persönlichen Welt Friedrichs des Großen, der Sibylle von Preußen auch als Autorin eine neue Dimension abgewonnen hat („Die Liebe des Königs“). Trotz ihrer schmückenden Funktion als Jagdszenen in Schloss Sanssouci, waren die Ornamente bereits im Original von den Idealen der französischen Aufklärung geprägt. Anders als bei konventionellen Jagdszenen zu erwarten, finden sich nicht Jagende und Gejagte, sondern erstaunlich autonome Kreaturen. Das ursprünglich randständige Ornament gewinnt Eigenständigkeit durch seine Reduzierung durch den künstlerischen Prozess auf wesentliche Formen. Aus aufgespannten Leinwänden entwickeln sich freie Scherenschnitt-Formen, die den vorgegebenen Keilrahmen gewissermaßen hinter sich lassen. In ihrer neuen Eigenständigkeit werden sie zu Kreaturen, die den Fabeln von Lafontaine oder den Metamorphosen Ovids entsprungen seien könnten. Durch starke Variationen der Betrachtungsnähe werden die Grenzen zwischen abstrakter und gegenständlicher Kunst aufgehoben. Die Vereinfachung der Form und die Farbgebung führen zu einer Immaterialität des Objektes, die Gegenständlichkeit wird Ausdruck einer abstrakten Idee, die sich kindlich und kultiviert zugleich artikuliert. Das Ende der Gegensätze auf unterschiedlichen Ebenen (Wolf Lepenies).
Karin Pott und Dr. Alexandra von Stosch werden in die Ausstellung einführen.